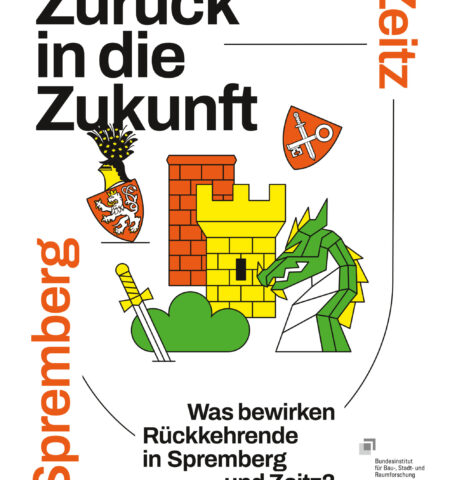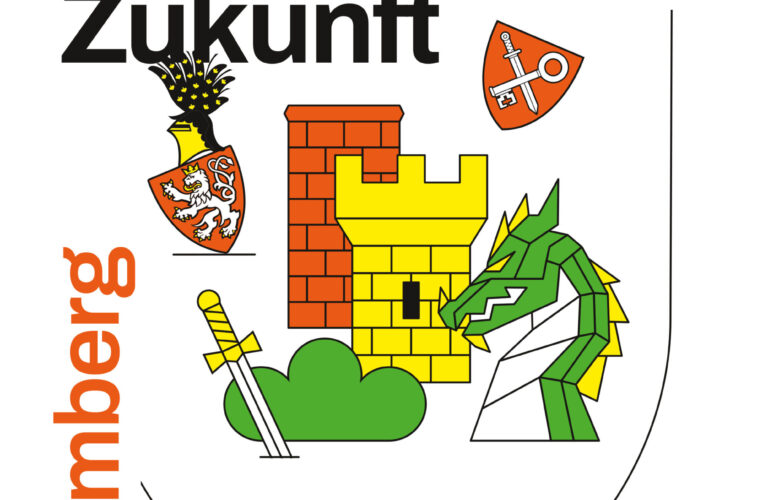Spremberg und Zeitz?
Das Institut für Resilienz im ländlichen Raum mit Sitz in Annahütte (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) entwickelt innovative Ansätze für die Zukunft ländlicher Regionen. Wir arbeiten in den Transformationsregionen Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen – dort, wo der demographische Wandel bereits heute Realität ist.
Wir wollen im ländlichen Raum von einer Defizit-orientierten Sichtweise, die primär die negativen Auswirkungen von Schrumpfung und Alterung hervorhebt, zu einer Potenzial- und Chancen-orientierten Perspektive zu kommen. Der Schlüssel dazu liegt in der Resilienz – der Fähigkeit, sich an Veränderungen anzupassen und aus Krisen gestärkt hervorzugehen. Wir zeigen, wie ländliche Regionen als Experimentierfelder für eine nachhaltige Postwachstumsgesellschaft dienen können.
Was ist Resilienz im ländlichen Raum?
Urbane Resilienz beschreibt die Fähigkeit, die Vulnerabilität einer Stadt zu reduzieren und gleichzeitig Widerstandskraft zu entwickeln, um künftige Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Sie ist ein Ausdruck von Lebensmut, der darauf abzielt, Veränderungen dort aktiv herbeizuführen, wo sie möglich sind, und gleichzeitig zu akzeptieren, was sich nicht ändern lässt. Im ländlichen Raum hat Resilienz eine besondere Dimension: Hier geht es nicht um Wachstum um jeden Preis, sondern um kreative Lösungen mit weniger Menschen und Ressourcen.
Ländliche Resilienz heißt:
- Etablierte Denkweisen hinterfragen
- Das städtische Wachstumsparadigma überwinden
- Von Rückkehrern als „Change Makers“ lernen
- Verwaltungsstrukturen optimieren
- Multi-Tasking und Automatisierung nutzen
- Selbstwirksamkeit erlebbar machen: Jeder kann etwas bewirken
Dabei setzen wir auf eine Potenzial-orientierte Perspektive statt auf Defizit-Denken. Ländliche Räume haben einzigartige Stärken – wir helfen dabei, diese zu erkennen und zu nutzen.
Warum ländliche Resilienz jetzt wichtig ist
Die demographische Entwicklung Deutschlands wird von zwei Polen geprägt: moderat wachsende urbane Ballungsräume auf der einen Seite, ländliche Regionen mit Alterungs- und Schrumpfungsprozessen auf der anderen. Besonders der Osten Deutschlands steht vor diesen Herausforderungen. Eine alternde Gesellschaft, die weniger konsumiert und investiert, verlangsamt die wirtschaftliche Dynamik, führt zu einer Ausdünnung der Nah- und Gesundheitsversorgung, zurückgehenden öffentlichen Ressourcen, unbesetzten Stellen sowie leerstehenden Immobilien. Ein Blick in diese Regionen und auf ihre Strategien, mit diesen Phänomenen umzugehen, kann also als Blick in eine Zukunft verstanden werden, die anderen Teilen unseres Landes und Europas noch bevorsteht.
Lange Zeit standen urbane Zentren im Fokus von Planung und Förderprogrammen. Ländliche Gebiete blieben oft außen vor – sei es durch komplexe Antragsverfahren oder abstrakte Konzepte, die nicht an die Lebensrealität vor Ort anknüpften. Wir entwickeln Lösungen aus einer dezidiert ruralen Perspektive. Dabei berücksichtigen wir die engen Verflechtungen zwischen Stadt und Land, die durch Energiewende, regionale Wertschöpfungsketten und Wohnraumknappheit in Metropolen noch zunehmen werden.
Zwischen Stadt und Land vermitteln
Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist die zunehmende Polarisierung zwischen Stadt und Land. Geringschätzung und Unverständnis auf beiden Seiten gefährden den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir schaffen Verständnis zwischen urbanen und ruralen Lebenswelten. Für eine resiliente, zukunftsfähige Entwicklung braucht es gegenseitige Wertschätzung und Respekt.
Vom Land lernen: Lösungen für den demographischen Wandel
Der ländliche Raum und die Lausitz benötigen unterstützende Strukturen, eine starke Zivilgesellschaft und positive planerische Visionen, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Hier wird bereits heute gezeigt, wie trotz rückläufiger Bevölkerungszahlen eine nachhaltige und demokratische Zukunft gestaltet werden kann.
Warum das auch für Städte relevant ist?
Die Vorboten des demographischen Wandels erreichen mittlerweile auch die Metropolen – durch Fachkräftemangel und zurückgehende Geburtenraten. Wir dokumentieren und vermitteln die Ansätze, die im ländlichen Raum zu mehr Resilienz geführt haben. So können städtische Regionen von den Erfahrungen und Innovationen des ländlichen Raums lernen und sich frühzeitig auf ähnliche Herausforderungen vorbereiten.
Evidenzbasierte Resilienz statt Wunschdenken
Obwohl Prognosen wie die des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) die demografische Entwicklung deutlich aufzeigen, bleibt das Bewusstsein dafür in der breiten Öffentlichkeit gering. Die Folge: Gesellschaftliche Probleme, die sich im ländlichen Raum manifestieren, werden oft anderen Faktoren zugeschrieben, statt sie als das zu erkennen, was sie häufig sind – Folgen des demografischen Wandels.
Wir setzen auf evidenzbasierte Arbeit statt auf Wunschdenken oder Hörensagen. Nur durch eine sachliche Analyse der tatsächlichen Ursachen können wirksame Lösungen entwickelt werden. Dabei ist es wichtig, den demografischen Wandel nicht als Ausrede zu nutzen, sondern als Ausgangsbedingung zu verstehen, die neue, kreative Ansätze erfordert. Resilienz entsteht nur dort, wo Probleme klar benannt und ihre Wurzeln verstanden werden. Erst dann können tragfähige Strategien entwickelt werden, die den ländlichen Raum wirklich stärken.
Unser Ansatz: Praxis trifft Wissenschaft
Das Institut für Resilienz im ländlichen Raum verbindet praktische Projekte mit wissenschaftlicher Forschung. Wir arbeiten direkt mit den Menschen vor Ort zusammen und entwickeln gemeinsam Lösungen, die funktionieren und Spaß machen. Der ländliche Raum kann seine Zukunft aktiv gestalten und dabei Vorbild für andere Regionen werden. Wir unterstützen diese Transformation mit Expertise, Netzwerken und konkreten Projekten.
Katastrophenschutz als Ehrenamt
Deutschland hat nach Österreich mit über 95 Prozent den zweithöchsten Anteil an freiwilligen Helfer:innen in der Feuerwehr. Dies zeigt eindrucksvoll, wie stark das Ehrenamt in Deutschland verankert ist und wie entscheidend es für den Katastrophenschutz ist. Der hohe Anteil an Freiwilligen ist ein Zeichen für den ausgeprägten Gemeinschaftssinn und die Bereitschaft, sich für das Wohl anderer einzusetzen. Katastrophenschutz in Deutschland ist somit in vielerlei Hinsicht ein Ehrenamt.
Diese beeindruckende Beteiligung ist möglich, weil die Ausbildung der Helfer:innen, die Bereitstellung von Material und Technik sowie der soziale Zusammenhalt aktiv von Kommunen, Ländern und auf Bundesebene unterstützt und finanziert werden. Die kontinuierliche Unterstützung und Förderung durch verschiedene Ebenen der Regierung schaffen ein solides Fundament für ein robustes und effektives Katastrophenschutzsystem. Durch diesen langjährigen Aufbau haben wir in Deutschland resiliente Strukturen geschaffen, um die uns viele andere Länder beneiden.
Wir sind selbst aktives Mitglied der Feuerwehr und haben durch unseren ehrenamtlichen Einsatz die Möglichkeit, bewährte Systeme und Strukturen aus erster Hand zu studieren. Diese Strukturen sind universell und daher im Krisenfall jederzeit einsatzfähig. Die wertvollen Erkenntnisse, die wir aus diesen Einsätzen gewinnen, übertragen wir auf den Kontext der räumlichen Entwicklung. Daraus leiten wir Ansätze für eine intelligente und krisenfeste Steuerung ab, die auf den Prinzipien der Resilienz und der Gemeinschaftsunterstützung basieren.
Das Ehrenamt in der Feuerwehr lehrt uns nicht nur technisches Wissen und praktische Fähigkeiten, sondern auch den Wert von Zusammenhalt, Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung. Diese Werte sind essenziell für die Schaffung einer widerstandsfähigen Gesellschaft, die in der Lage ist, Herausforderungen und Krisen erfolgreich zu bewältigen. Durch unser Engagement und die Anwendung dieser Prinzipien auf verschiedene Bereiche der räumlichen Entwicklung tragen wir aktiv dazu bei, eine nachhaltige und sichere Zukunft zu gestalten.
Künstliche Intelligenz und digitale Transformation
Unter dem Begriff „digitale Transformation“ werden oft Entwicklungen wie Online-Shopping, Social Media oder Home-Office zusammengefasst. Wir sind jedoch der Meinung, dass die eigentliche Transformation durch künstliche Intelligenz (KI) angetrieben wird und noch umfassendere und positivere Veränderungen mit sich bringen wird. KI-Technologien wie autonomes Fahren, Tools zur Musikkomposition und zur Redaktion von Texten sind bereits Realität. Intelligente Video- und Bildgeneratoren, die früher als skurril galten, zeigen heute beeindruckende Fortschritte und Anwendungsmöglichkeiten.
Die Einführung und Verbreitung von KI bringt enorme Chancen mit sich. Während einige der bisherigen Gewinner:innen der digitalen Entwicklung des letzten Jahrzehnts sich anpassen müssen, eröffnet KI neue Möglichkeiten und Wettbewerbsvorteile. Berufsbilder und unternehmerische Konzepte stehen vor einer spannenden Neugestaltung, wobei neue Arbeitsfelder und innovative Geschäftsmodelle entstehen werden. Auch traditionelle Berufe wie die von Fernfahrer:innen oder Handwerker:innen werden von diesen Entwicklungen profitieren, indem sie sich durch neue Technologien weiterentwickeln.
Die gesellschaftlichen und ökonomischen Konsequenzen dieser Transformation sind vielversprechend. Besonders im ländlichen Raum bieten sich großartige Chancen. Automatisierte Routinetätigkeiten können Arbeitskräfte entlasten, sodass sie sich auf kreativere und wertschöpfendere Aufgaben konzentrieren können. Dies fördert nicht nur die Effizienz, sondern auch die Lebensqualität und Zufriedenheit der Menschen.
Ein proaktiver und selbstbewusster Umgang mit der digitalen Transformation ist entscheidend für eine resiliente Zukunftsentwicklung der Kommunen, insbesondere im ländlichen Raum. Durch die kluge Integration von KI-Technologien können wir die Resilienz unserer Gemeinschaften stärken und nachhaltige Entwicklung fördern.
Unsere Zukunft hängt davon ab, wie wir diese Technologien nutzen und anpassen. Durch eine positive und weitsichtige Anwendung von KI können wir nicht nur die Herausforderungen meistern, sondern auch erhebliche Vorteile und Verbesserungen in verschiedenen Lebensbereichen erzielen. Das Ziel ist es, durch innovative Ansätze eine widerstandsfähigere, gerechtere und nachhaltigere Gesellschaft zu schaffen.
Insgesamt bietet die digitale Transformation 2.0, angetrieben durch KI, eine Fülle von Möglichkeiten, unsere Welt positiv zu verändern. Indem wir diese Technologien nutzen, können wir eine nachhaltigere und resilientere Zukunft gestalten, die das Potenzial der KI voll ausschöpft und die Lebensqualität aller verbessert.
Was ist spezifisch an Resilienz im ländlichen Raum?
Der ländliche Raum – besonders im Osten Deutschlands – galt lange Zeit als Verlierer der Globalisierung. Landflucht und demografischer Wandel schienen übermächtige Herausforderungen zu sein, die zu Schrumpfung und Leerständen führten. Doch gerade hier haben die Menschen eine beeindruckende Transformationserfahrung gesammelt. Werte wie Traditionsbewusstsein, Zusammenhalt und ehrenamtliche Hilfe prägen die Gesellschaft.
In jüngster Zeit entscheiden sich jedoch immer mehr Menschen bewusst für eine Rückkehr in den ländlichen Raum. Sie schätzen nicht nur die Lebensqualität und Ruhe, sondern legen besonderen Wert auf soziale Faktoren wie die Nähe zu Familie und Freundeskreis. Die Rückkehrer bringen gleichzeitig neue Perspektiven und Fähigkeiten mit, die die Resilienz des ländlichen Raums stärken.
Was können wir aus dieser Entwicklung für aktuelle Krisen lernen? Der ländliche Raum zeigt, dass Resilienz auf starken sozialen Netzwerken und dem engen Gemeinschaftsgefühl basiert. Diese Aspekte sind besonders wertvoll, um die Verwundbarkeiten der modernen Gesellschaft zu reduzieren und spezifische Fähigkeiten zur Widerstandsfähigkeit zu stärken. Strategische Anpassungsfähigkeit bedeutet, zukünftige Krisen zu antizipieren und entsprechende Vorbereitungen zu treffen. Redundante und sich ergänzende Strukturen sind dabei ebenso wichtig wie technische und soziale Innovationen. Im ländlichen Raum kann dies durch die Förderung von Gemeinschaftsprojekten, die Nutzung erneuerbarer Energien und die Stärkung lokaler Wirtschaftskreisläufe geschehen.
Die Transformation des Systems, um zukünftige Störungen zu vermeiden, sollte auf einer Kombination aus Bewährtem und Neuem basieren. Die Rückkehrer und ihre neuen Ideen spielen dabei eine Schlüsselrolle. Durch den Austausch von Erfahrungen und die Integration moderner Technologien kann der ländliche Raum widerstandsfähiger und zukunftsfähiger werden.
Der ländliche Raum bietet eine starke Basis für Resilienz. Die Rückkehr vieler Menschen, die besonderen Wert auf soziale Faktoren wie Familie und Freundeskreis legen, verstärkt diese positive Vision für die Zukunft. So kann der ländliche Raum zu einem Modell für nachhaltige und resiliente Entwicklung werden, das auch in Zeiten multipler Krisen Hoffnung und Stabilität bietet.